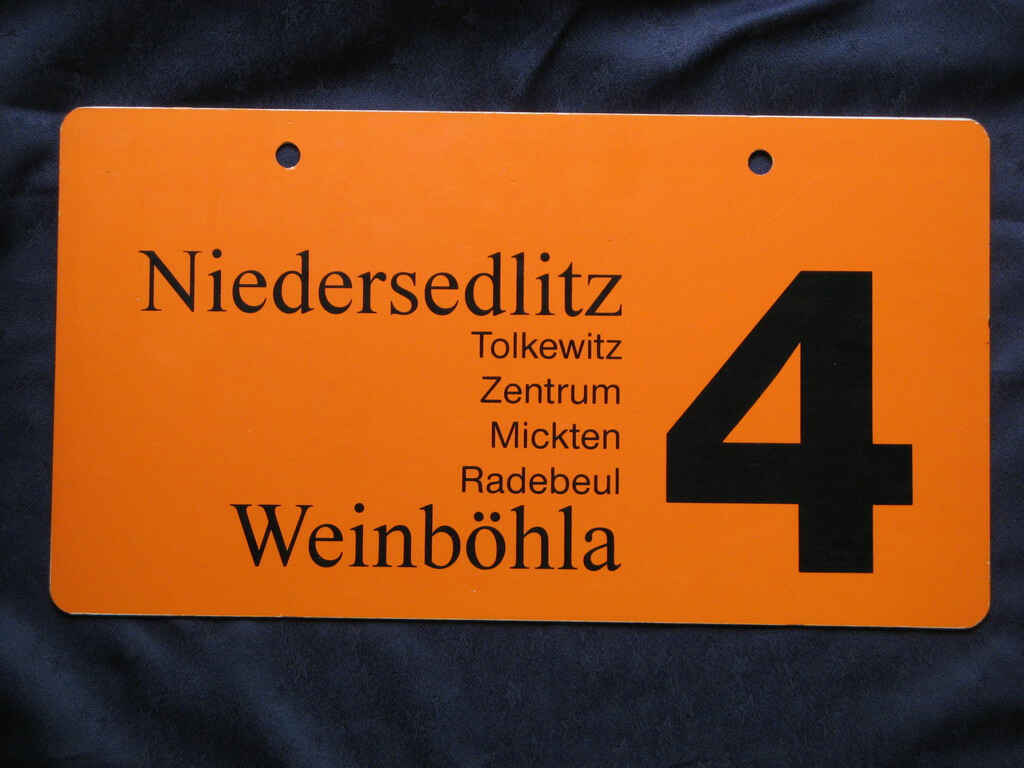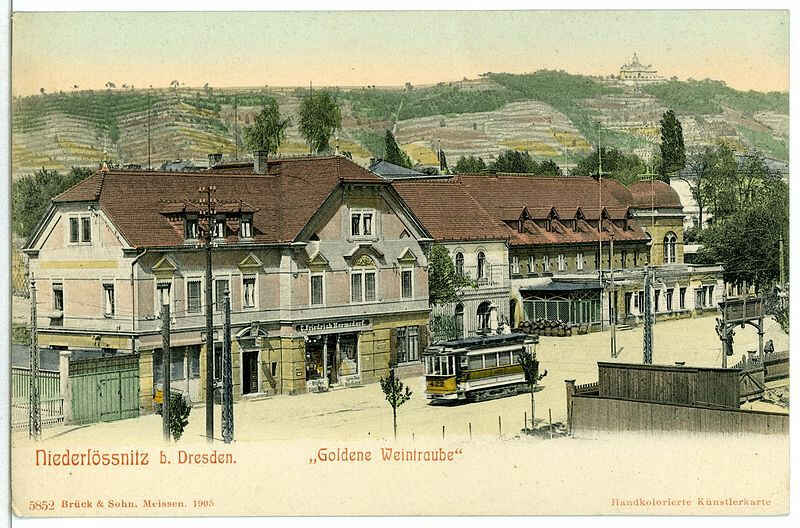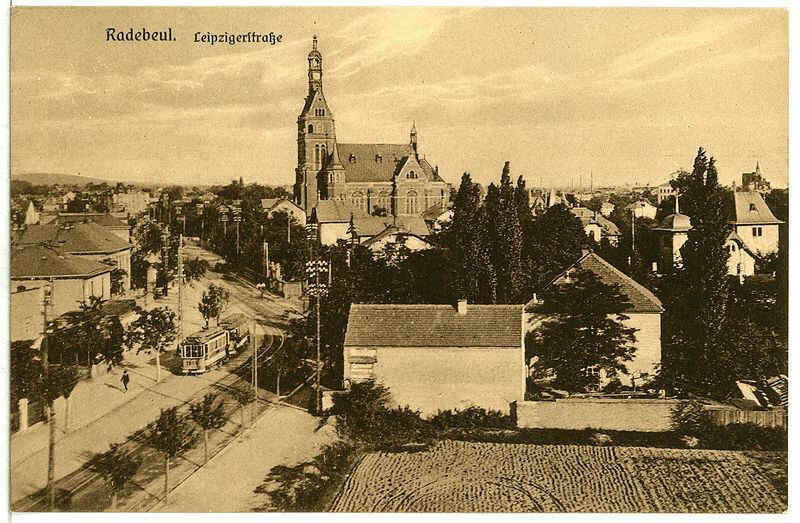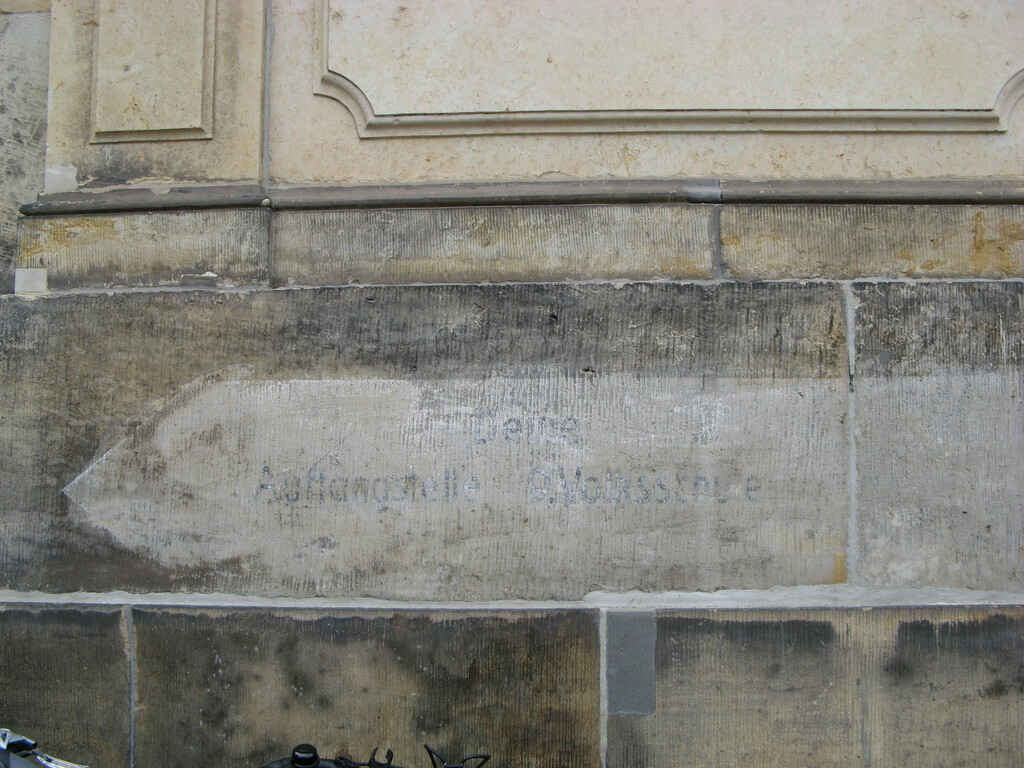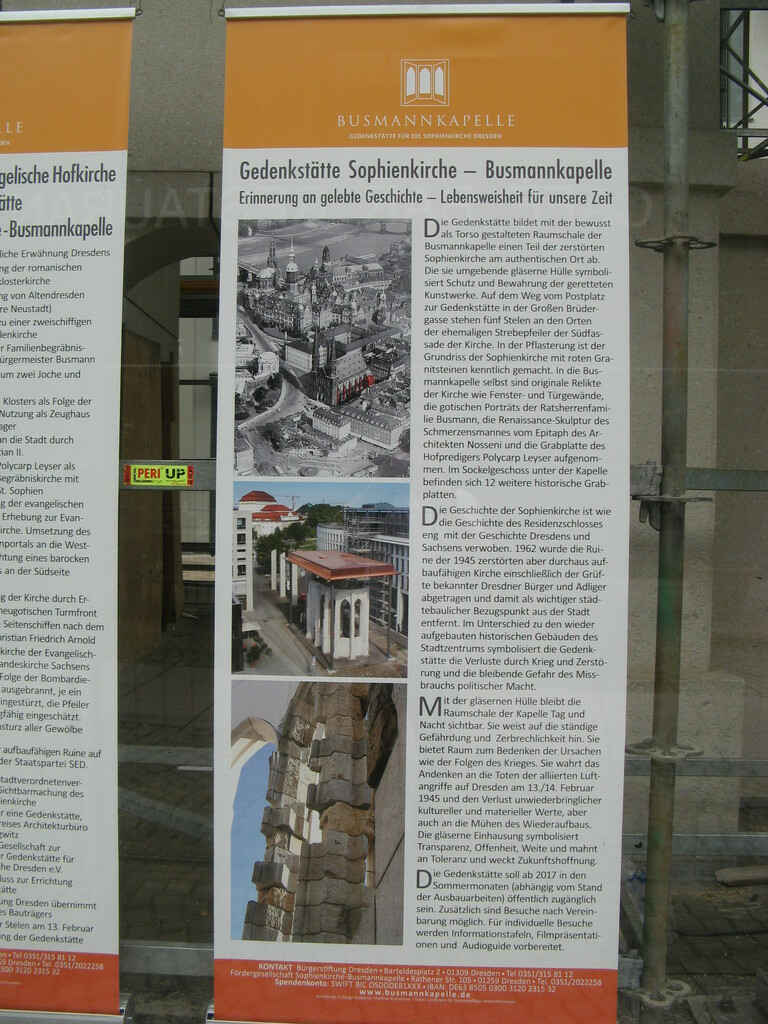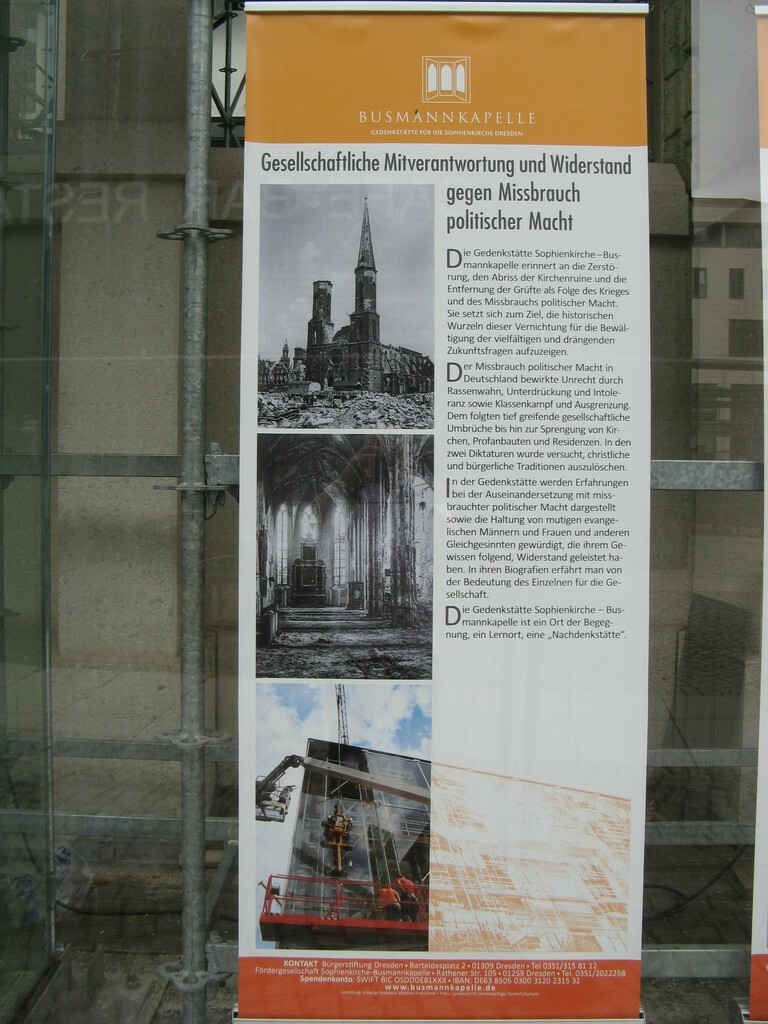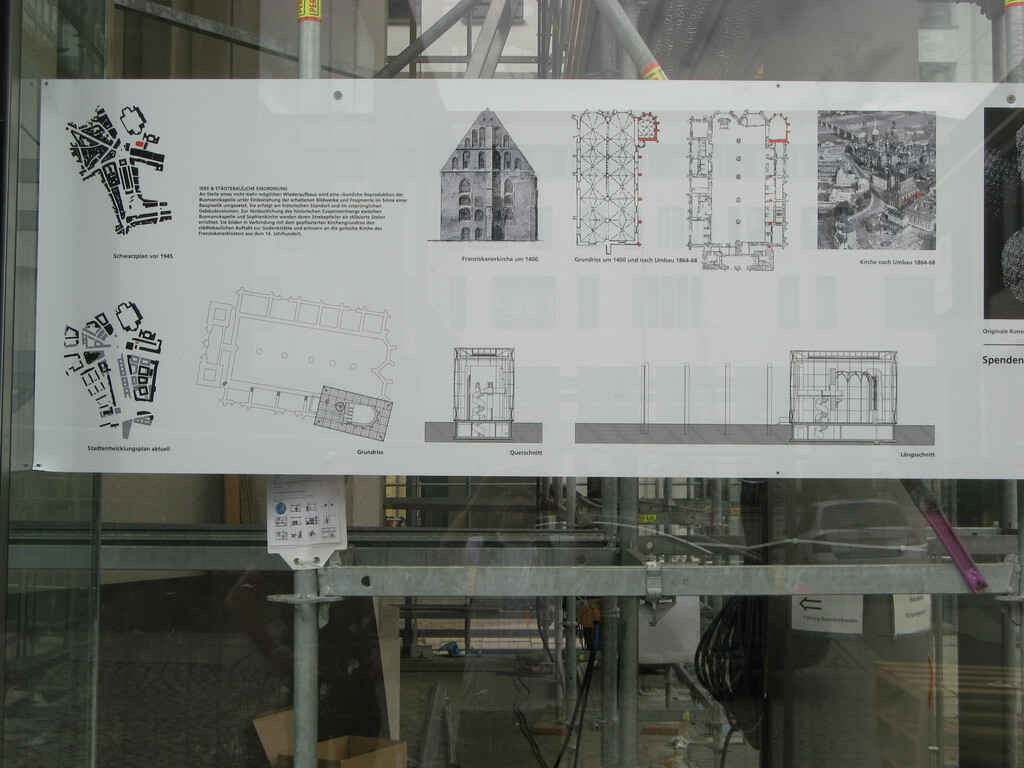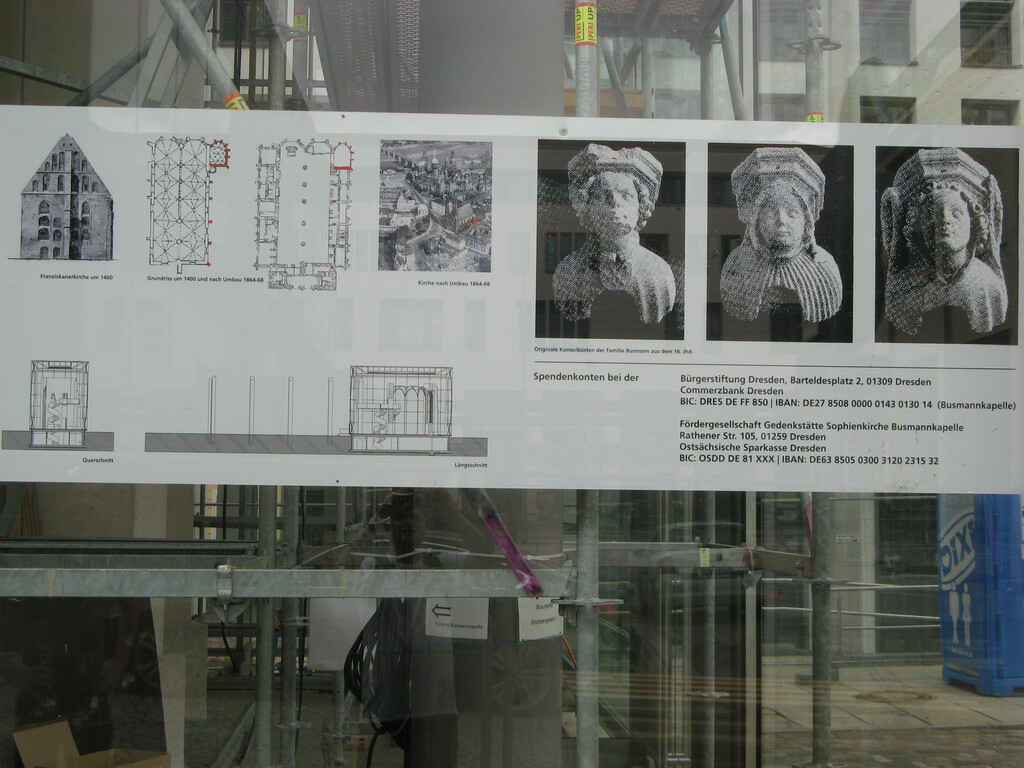Der Mittlere Ring (Teil IV)
Weiter geht es rundherum mit einigem Abstand zur Dresdner Innenstadt auf dem geplanten Mittleren Ring. Die östliche Stübelallee, im Moment in dichter Frequenz durch die Linien 1, 2 und 44 befahren, haben wir ausgelassen und beginnen wieder an der Zwinglistraße. Bis zum großen Umbau der Gleisanlagen auf der Bodenbacher, Pirnaer Land- und Zwinglistraße um die Jahrtausendwende lag die Haltestelle noch ums Eck.

Blick auf die aktuelle „Zentralhaltestelle“. Ab hier folgt die geplante Ringbahn der heutigen Bus- und ehemaligen Obuslinie 61 nach Löbtau, allerdings mit einigen leichten Abweichungen, wie wir gleich sehen werden. Unstrittig ist jedoch, dass der 1947 eröffneten Obuslinie C (und deren Nachfolgerin) die ursprünglichen Ringplanungen teilweise zugrundelagen, wenn man auch aus Kostengründen auf teure Gleisanlagen verzichtete. Dass die aktuell im Raum stehende Umwandlung in eine Straßenbahnstrecke jedoch stets eine Option war, beweist der Grünstreifen auf dem Anfang der 1970er Jahre beträchtlich ausgebauten Zelleschen Weg…

Zwar schon gezeigt, aber aus Dokumentationsgründen natürlich unumgänglich ist die „Grüne Wiese“. Hier wäre der Ring aus der in die Bodenbacher Straße abbiegende Strecke nach Seidnitz ausgeschert und weiter gerade der Zwinglistraße gefolgt.


Bodenbacher Straße mit Linie 44. In wenigen Monaten wird diese bereits wieder historisch sein, denn eine Wiederholung des aktuellen, etwas absurden Betriebsregimes im Dresdner Osten dürfte es kaum geben.

Blick in die Zwinglistraße, die hier möglicherweise mittelfristig tatsächlich eine Gleisanlage sehen wird.

Zwinglistraße, Blick zurück zur Haltestelle.

Kreuzung Zwinglistraße/Grunaer Weg und Winterbergstraße. Stets bog hier die Linie C, heute 61, nach rechts in Richtung Großer Garten ab. Der Mittlere Ring wäre dem ausgebauten Grunaer Weg bis zum Ende der Tiergartenstraße gefolgt.

Doch auch die Winterbergstraße verfügt über einen prophylaktisch angelegten Bahnkörper, diese Planstrecke hätte hier den Ring gekreuzt. Eine durchgehende Nahverkehrsverbindung bestand auf der Straße nur kurzzeitig bis 2009 in Form der Buslinie 89. Das jahrzehntelange Ausbleiben der ursprünglich durchgehend geplanten großstädtischen Bebauung bis nach Seidnitz hinein verhinderte bis heute eine sinnvolle Umsetzung dieser durchgehenden geradlinigen Straßenbahnstrecke, zudem ist die parallele Bodenbacher Straße nur wenige Steinwürfe entfernt und straßenbahntechnisch gut bestückt.


Grunaer Weg mit Fraunhofer-Institutsgebäuden links.

Grunaer Weg, Blick Richtung Winterbergstraße. Der unterbliebene Ausbau verhindert bislang die 2009 bereits geplante Umverlegung der 61, die somit den Busbetriebshof Gruna erschlossen hätte.

Am Ende der Tiergartenstraße.

Unscheinbar zeigt sich die Einfahrt in den größten Omnibus-Betriebshof der Stadt, erst ganz zum Ende der 1980er Jahre durch die Verkehrsbetriebe vom Kraftverkehr übernommen. Die Bushaltestelle dient heute fast nur noch dem Werks- und Einrückeverkehr.

Einen Anschluss an den Nahverkehr erhielt das Gelände erstmals Ende 1988 durch die verlängerte 89. Damals hieß der Endpunkt noch „VEB Kraftverkehr“.


Wieder physische Zeugen des Mittleren Ringes offenbaren sich: Das Endstück der Tiergartenstraße verfügt ebenfalls über einen Grünstreifen, der als Gleiskörper für den Mittleren Ring fungieren sollte.

Tiergartenstraße mit Gleiskörper, nach Osten geschaut.

Um den Ersten Weltkrieg herum entstandene Villen an der Tiergartenstraße.


Wir passieren die Basteistraße. Von den hochfliegenden Großstadtplanungen blieben nach dem Ersten Weltkrieg nur abgespeckte Reste übrig. Dies erinnert entfernt an den merkwürdigen innerstädtischen Eigenheimbau entlang der Bertold-Brecht-Allee.

Bahnkörper in der Nähe der Kreuzung Tiergartenstraße/Karcherallee.

Heute kaum noch genutzte Haltestelle in der Tiergartenstraße.

Die seit einigen Jahren fehlende direkte Omnibuisanbindung des Bushofes Gruna erfordert einen regelmäßigen Werksverkehr, der aber nicht mehr für die Allgemeinheit freigegeben ist.

Kreuzung mit der Karcherallee. Hier treffen wir kurz auf die 61, die seit 1989 in Richtung Haltepunkt Strehlen abbiegt. Vorher fuhr sie weiter über die Karcherallee-Rayskistraße nach Strehlen.

Am Basteiplatz. Paluccaschule und historisches Straßenschild aus den Endzwanzigern.


Hinter der Bahnunterführung sahen die Planungen einen Stadtplatz mit sternförmig abzweigenden Straßen vor. Die durch die Straßenbahn genutzte Planstraße wäre direkt auf die Christuskirche zugelaufen, wurde aber nie gebaut.

Geplante Streckenführung des Mittleren Ringes in Strehlen, auf einem aktuellen Luftbild (Themenstadtplan).

Wir machen in Ermangelung der direkten Straße zwangsweise den bis 1989 auch vom Bus befahrenen Umweg über Rayski- und Reicker Straße. Es grüßt die 77 Meter hohe Doppelturmfront der Christuskirche.

Rondell An der Christuskirche. Heute führt die öffentliche Straße nur südlich der Kirche vorbei, die eigentliche Nordfahrbahn wurde nie für den Durchgangsverkehr genutzt.

Den Teil beenden wir mit einer Postkartenaufnahme der Christuskirche, die zu ihrer Erbauungszeit noch völlig allein auf weiter Flur stand.