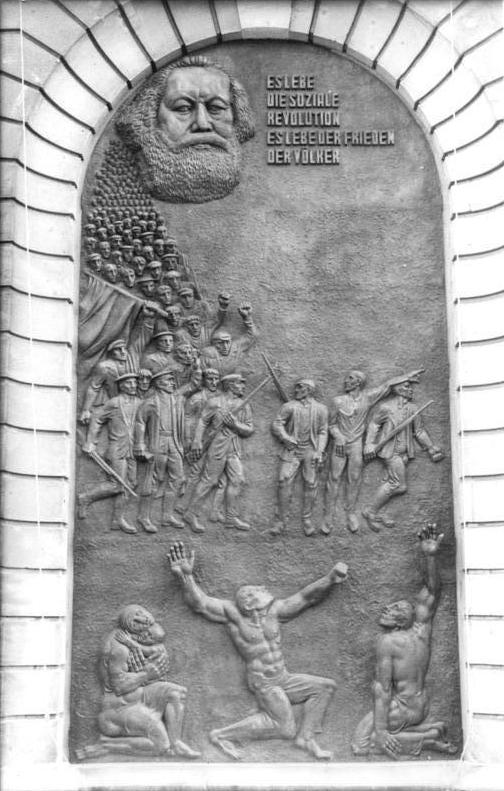Vorab: Ich finde die Debatte über die Tafeln hochinteressant. Vielleicht kann sie in den Dimensionen-Strang verschoben werden, weil sie dort jetzt, wo die Tafeln hängen, besser aufgehoben ist. Sie mit dem Hinweis auf "Moralismus" bzw. "politische Korrektheit" abzuwürgen, erscheint mir aber wie intellektuelle Zwangsdiät.
Also los, ganz ohne Zorn und Eifer:
Das ‘aufgeklärt' bezog sich auf 'Sic gesturus sum principatum, ut sciam, rem populi esse, non meam privatam.’
Hier mal die Übersetzung, wie sie zum Beispiel hier von der Berliner Zeitung zitiert wird:
„Ich werde mein Königsamt so führen, dass ich weiß, dass es sich um die öffentliche Angelegenheit und nicht um meine Privatangelegenheit handelt."
Tatsächlich zeigt das gegenüber der Szene von 1443 einen Unterschied im Herrscher-Selbstbild: Friedrich II. (der Kurfürst) versteht sich noch als personaler Herrscher im Sinne eines Lehnsherren und sagt deshalb im Kern: "Ich will nicht mehr als mir zusteht". Friedrich I. (der König) versteht sich 250 Jahre später als Herrscher eines Staates. "Aufgeklärt" im Sinne der Aufklärung des 18. Jahrhunderts mit ihrer "Herrschaft der Vernunft" und den Naturrechten des Einzelnen war das noch lange nicht. Man kann höchstens von der Entwicklung rationalerer Herrschaftsformen reden, wie sie für den Absolutismus typisch ist (Stichwort: Merkantilismus).
Insgesamt finde ich die obige Übersetzung missverständlich, vor allem bei "Prinzipat" als "Königsamt" und "res populi" als "öffentliche Angelegenheit". Denn ein absolutistischer Herrscher verstand sich nicht als "Amtsträger" im Rahmen einer Rechtsordnung, sondern als König von Gottesgnaden – er vergibt die Ämter, er hat keines. Und "öffentliche Angelegenheit" wäre res publica, also ursprünglich die römische Republik mit ihren politischen Institutionen und Debatten. "Res populi" heißt wörtlich zwar "Angelegenheit des Volkes", wäre hier m.E. aber besser mit "Staat" zu übersetzen (weil "das Volk" im Absolutismus anders als im alten Rom kein Rechtssubjekt ist).
Meine Übersetzung hieße: "So werde ich meine Herrschaft führen, dass ich weiß, dass sie der Staat ist, nicht meine Privatsache". Das unterscheidet sich nur in Nuancen von Ludwigs XIV. "L'etat c'mois!" – und das überrascht kein bisschen, denn so war nun mal das Herrscherbild des Absolutismus`.
Aber die Sache hat einen dialektischen Dreh: Dass Friedrich den Staat und seine Herrschaft in eins setzt, zeigt, dass beides bereits auseinanderfällt. 1443 war es noch eins – weshalb vom Staat keine Rede sein musste; 1700 muss die Einheit bereits proklamiert werden. Der König ernennt sich zur Staatsperson, weil sich der Staat als Herrschaftsmaschine vom König als Person zu lösen begann. Tatsächlich sind wir hier am Anfang eines Prozesses, an dessen Ende der Staat zu einem gewaltigen Apparat von Rechtsordnungen, Behörden, Institutionen und Armeen geworden war – und der König zu einem Grüßaugust an der Spitze, der sich durch einen Präsidenten austauschen lässt, ohne dass sich sonst etwas ändern müsste.
Dieses Ende ist 1902 eigentlich längst erreicht (schon Hegel beschrieb den König im 19. Jahrhundert nur noch als das "I-Tüpfelchen" des Staates). Wenn die Hohenzollern ihr Residenzschloss in diesem Stadium mit Szenen aus dem Mittelalter bzw. dem Absolutismus schmücken, dann heißt das vor allem: Wir wollen es nicht wahrhaben; wir wollen, dass wieder früher ist.