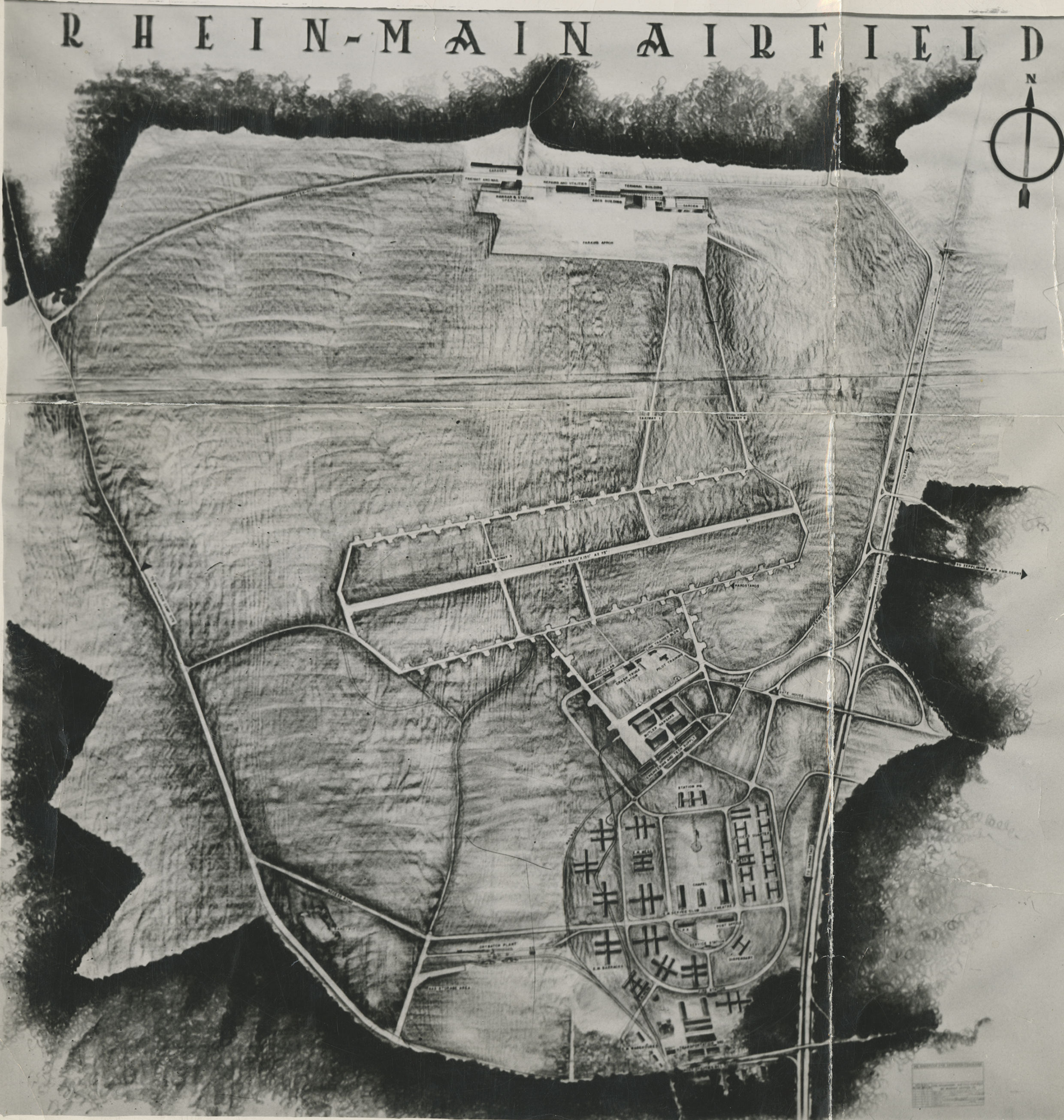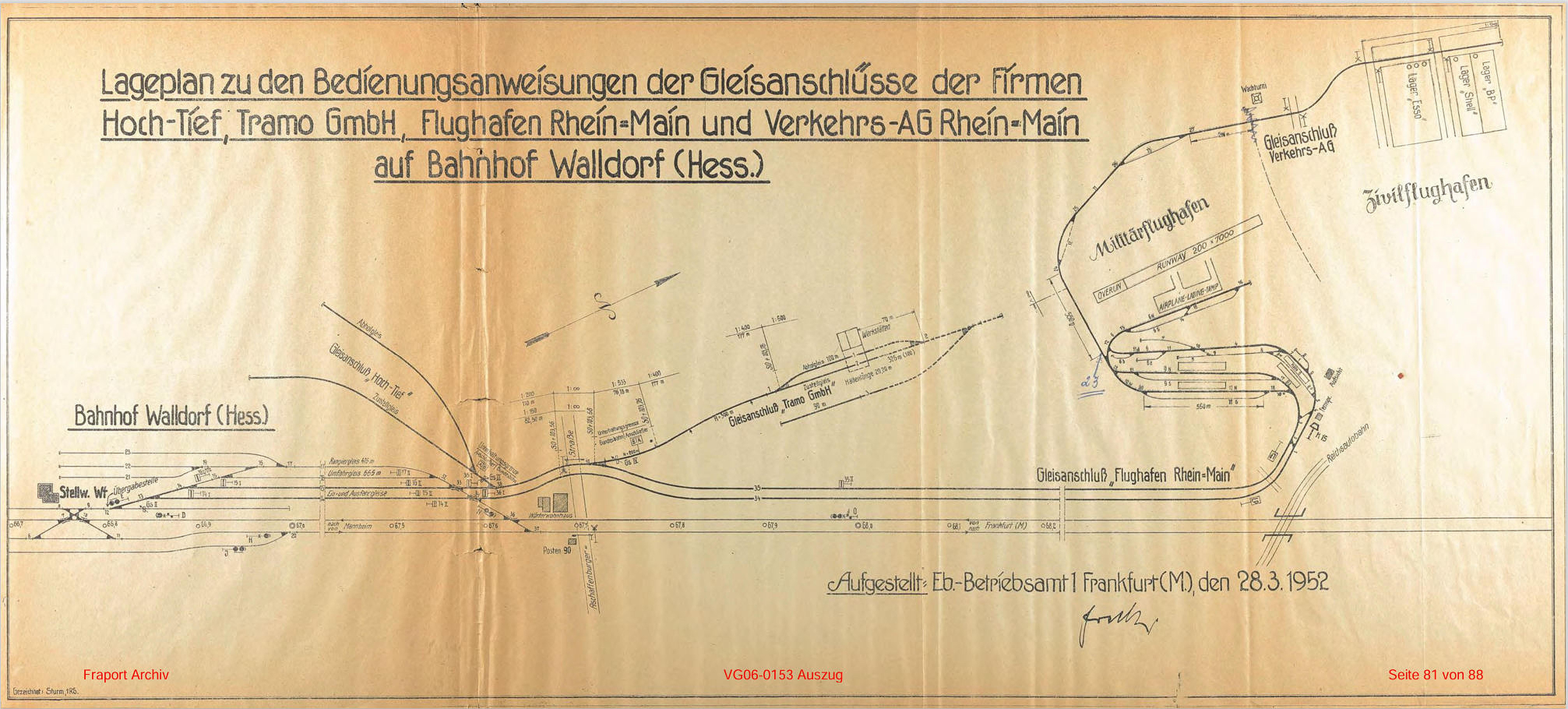Fahrzeugparade auf den umgebauten Gütergleisen der Cargo City Süd. Historische Dampflok und Cargo-Sprinter; 1997
Foto: Fraport AG Fototeam, FRAPORT-Archiv
Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens im Juli 2024 ist viel über den Frankfurter Flughafen berichtet und viel Bildmaterial zu seiner Geschichte veröffentlicht worden. In Vergessenheit geriet, dass der Rhein-Main-Flughafen seit seinem Umzug in den Frankfurter Stadtwald einen Eisenbahnanschluss hat, der für den Gütertransport zum Flughafen zu Zeiten erhebliche Bedeutung hatte. Flughafen und Eisenbahn wird gemeinhin mit S-Bahnanschluss und Fernbahnhof assoziiert. Dass über den alten Gleisanschluss wenig bekannt ist, mag daran liegen, dass er die längste Zeit ausschließlich militärischen Zwecken diente, dass er in den letzten 15 Jahren nur noch geringe praktische Bedeutung hatte und dass an einem Flughafen der Fokus des Interesses auf Flugzeugen und nicht auf Güterzügen liegt. Das Flughafenjubiläum ist Anlass, diesen Teil der Flughafenhistorie in den Blick zu nehmen.
Der Anfang 1937 - 1945
Als der neue Flug- und Luftschiffhafen Rhein-Main im Frankfurter Stadtwald am 8. Juli 1936 eröffnet wurde, zeigen die Kartenwerke in der Nordostecke des neuen Flughafengeländes das Empfangsgebäude mit einer Straßenanbindung von der Unterschweinstiege her (etwa dort, wo heute Terminal 2 steht), sowie im Zentrum des Geländes eine Luftschiffhalle, die über eine Straße entlang der damaligen Reichsautobahn Frankfurt – Darmstadt (heute BAB 5) und von Zeppelinheim erreichbar war. Eine Verbindung zum Schienennetz der Reichsbahn gab es zunächst nicht, obwohl zwei wichtige Bahnstrecken das Gelände in nur 1-2 km Abstand passieren, nördlich die Mainbahn nach Mainz und östlich die Riedbahn nach Mannheim. In Kelsterbach gab es ein Industriegleis zu einer Kiesgrube und einem Umspannwerk, das fast bis zur heutigen Landebahn Nordwest reichte.

Karte: Historische Topografische Karten (Open Data). Georeferenzierung und Bereitstellung: Hessisches Institut für Landesgeschichte (HIL); Meßtischblatt 5917, 1:25.000, Ausgabe 1935, letzte Ergänungen 1937, mit eigener Colorierung und Bildmontage des Gleisanschlusses.
Etwa ein Jahr nach der Eröffnung wurde mit dem Bau einer 2. Luftschiffhalle begonnen, im Sommer 1938 war sie fertiggestellt. Die Luftschiffhafen Rhein-Main GmbH, ein mit dem Flughafenbetreiber Südwestdeutsche Flugbetriebs AG Rhein-Main verbundenes Unternehmen, war Bauherr und Betreiber der Zeppelin-Hallen, sie hatte der Firma Seibert Stahlbau GmbH Saarbrücken den Bauauftrag zu einem Pauschalpreis von 2,3 Mio RM erteilt. Die vorgefertigten Teile für die Stahlkonstruktion der Halle sollten mit der Bahn zum Bauplatz gelangen, weshalb das Leistungsverzeichnis des Bauvertrages die Herstellung eines Privatgleisanschlusses zum Flughafen umfasste.
Im Sommer 1937 wurde in wenigen Wochen ein 3,23 km langes Gütergleis gebaut, das bei Riedbahn-Streckenkilometer 66,8 von einem Gütergleis im Bf. Walldorf abzweigte, westlich neben der Riedbahn nach Nordosten führte, vor der Autobahnüberführung nach Norden abknickte und in einem leichten Bogen zum Flughafengelände führte. Nach Beendigung des Auftrages hat die Fa. Seibert den gesamten Privatgleisanschluss an die Luftschiffhafen GmbH übereignet, der Bauwert war mit 198.000 RM beziffert worden. Die Gleise liefen über Gelände der Reichsbahn, des Landes Hessen, der Gemeinde Trebur und der Fa. Hoch-Tief AG, die dort am Bf. Walldorf einen Lagerplatz unterhielt.

Grafik: Genehmigungsplan der Fa. Seibert Stahlbau GmbH Saarbrücken, FRAPORT-Archiv
Im Plan der Fa. Seibert ist kurz nach der Hohewartschneise, also direkt an der Einfahrt zum Flughafengelände, ein Ladegleis mit Krananlage sowie eine „Gasspeicheranlage“ verzeichnet; das bezog sich auf eine Helium-Reinigungsanlage mit Gasometer für 14.000 Kubikmeter, eine Heliumlagerung für 200.000 Kubikmeter und eine Kraftstromzentrale für die Heliumgewinnung. Diese Anlagen sind aber nicht vollständig gebaut worden, weil die amerikanischen Patent- und Rechteinhaber für die Helium-Gewinnung den Bau in Nazi-Deutschland unterbunden haben. Die Zeppeline wurden deshalb mit Wasserstoff befüllt, der durch eine Rohrleitung von der 8 km entfernten Farbwerke Höchst AG zu den Luftschiffhallen gelangte. Eine Fotografie, wahrscheinlich von 1938, legt nahe, dass das Gütergleis später erweitert wurde, die im Bild erkennbare Verzweigung ist im Genehmigungsplan nicht enthalten.

Foto: FRAPORT-Archiv
Die Bilder aus der Bauzeit zeigen Menge und Größe der Hallenbauteile und machen Notwendigkeit und Nutzen des Bahnanschlusses unmittelbar deutlich.


Fotos: FRAPORT-Archiv
Die Zeppelinmotoren benötigten natürlich Treibstoff, weshalb im Bereich der Zeppelinhallen auch ein Treibstofflager gebaut wurde; es war an drei Mineralölunternehmen verpachtet worden, die Vorgängerfirmen von Esso, Shell und BP. Wir können annehmen, dass der Treibstoff wie damals üblich per Bahn angeliefert wurde. Die Kohle für die Heizzentrale der Luftschiffhallen wurde ebenfalls per Bahn geliefert. Aber wo genau die Gleise bei den Luftschiffhallen lagen, wissen wir nicht.
Den Luftschiffhallen selbst war keine lange Existenz beschieden. Am 6.5.1937 war der deutsche Zeppelin LZ-129 „Hindenburg“ nach einer Atlantik-Überquerung bei der Landung an seinem Ziellufthafen Lakehurst nahe New York verunglückt. Austretender Wasserstoff hatte sich entzündet, der Zeppelin verbrannte, 35 Menschen starben. Von diesem Unglück hat sich der kommerzielle Zeppelin-Flugbetrieb nicht mehr erholt, die deutschen Zeppeline wurden bei Kriegsbeginn 1939 abgewrackt, die Luftschiffhallen waren nutzlos geworden und wurden im Mai 1940 gesprengt. Wegen ihrer Größe galten sie als gut sichtbarer Ziel- und Orientierungspunkt für feindliche Flugzeuge.
Im Übrigen blieben aber die Flugplatzanlagen und der Gleisanschluss in Betrieb. Wo ursprünglich die Heliumgewinnungsanlage gebaut werden sollte, ist 1940/41 eine Anlage zur Sauerstoffgewinnung gebaut worden; sie gehörte der Luftschiffhafen Rhein-Main GmbH, die den erzeugten Sauerstoff per Bahn mit Kesselwagen und per LKW fast ausschließlich an die Luftwaffe lieferte. Ein Ausschnitt aus einem Plan von 1943 zeigt die Gleisanlagen in ihrer ursprünglichen Form, ohne die Luftschiffhallen und ohne die oben gezeigte Verzweigung des Gleises. Nach Sprengung der Luftschiffhallen, könnten die Gleisanlagen auf ihr ursprüngliches Format zurückgebaut worden sein.
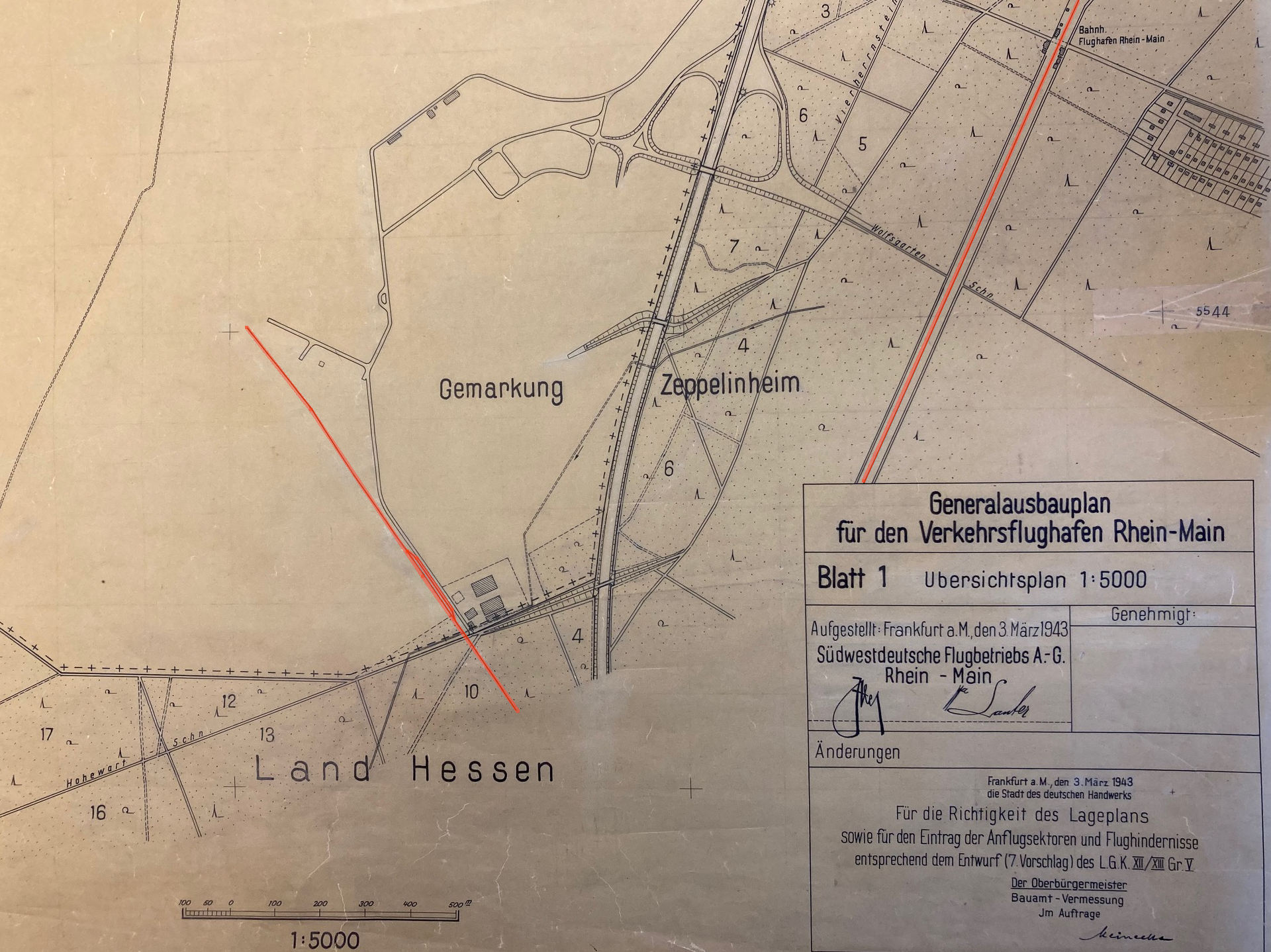
Grafik: Generalausbauplan 1943, Blatt 1, Auszug, coloriert, ISG Sig. S-8 3,871
(wird fortgesetzt)