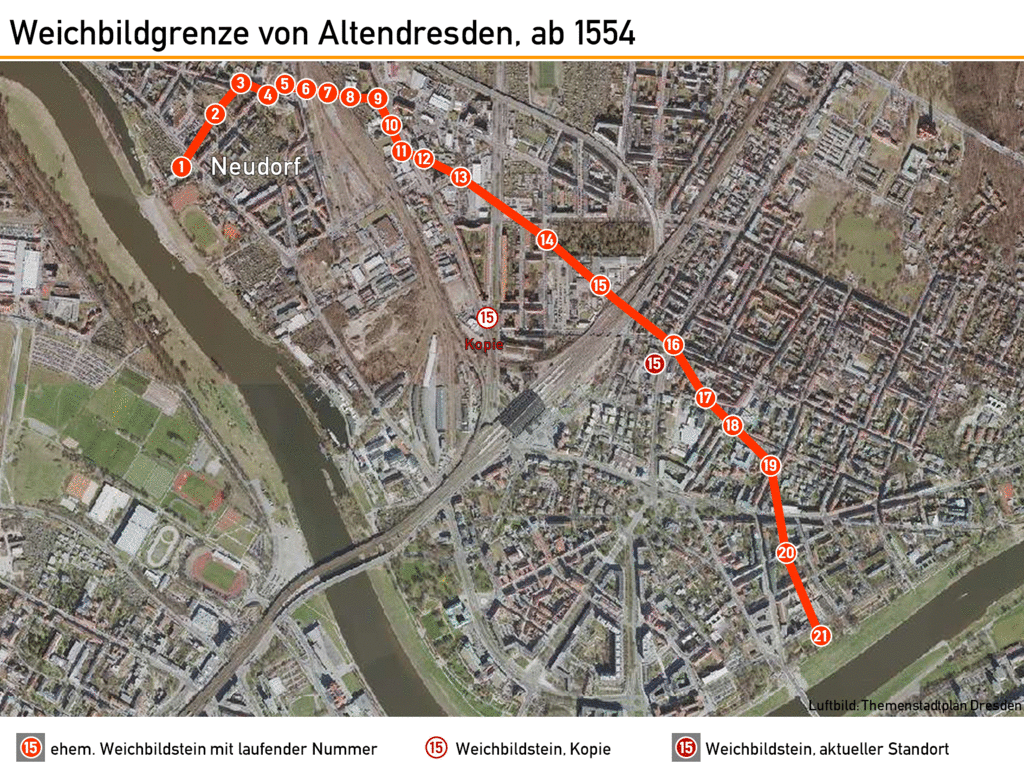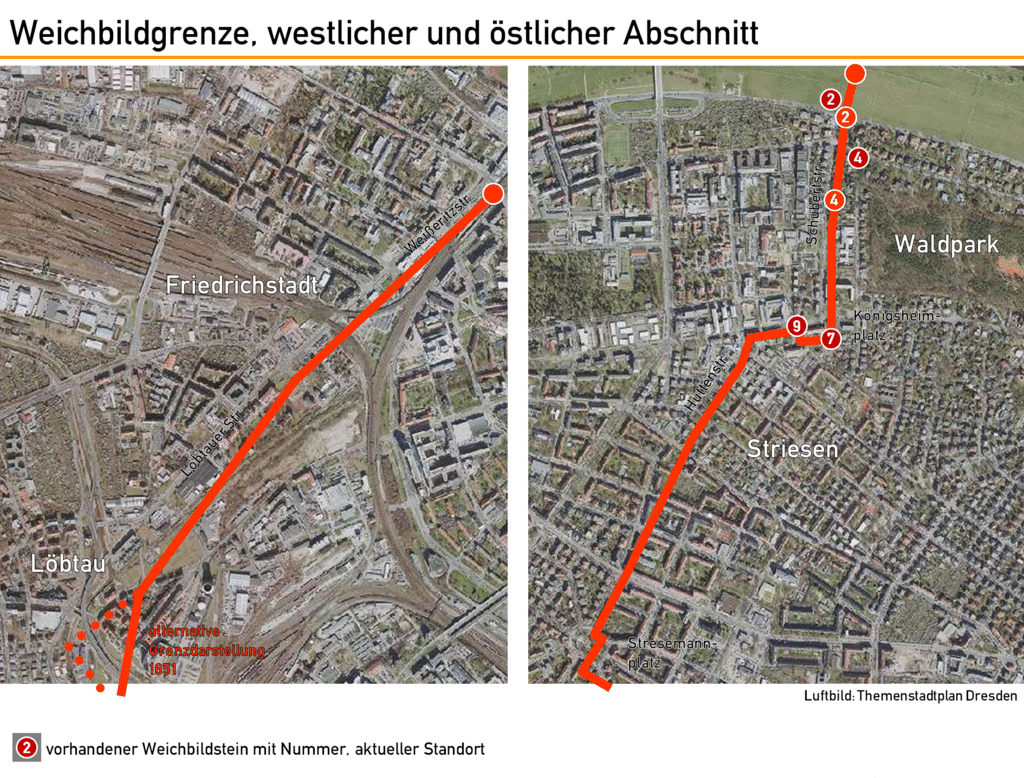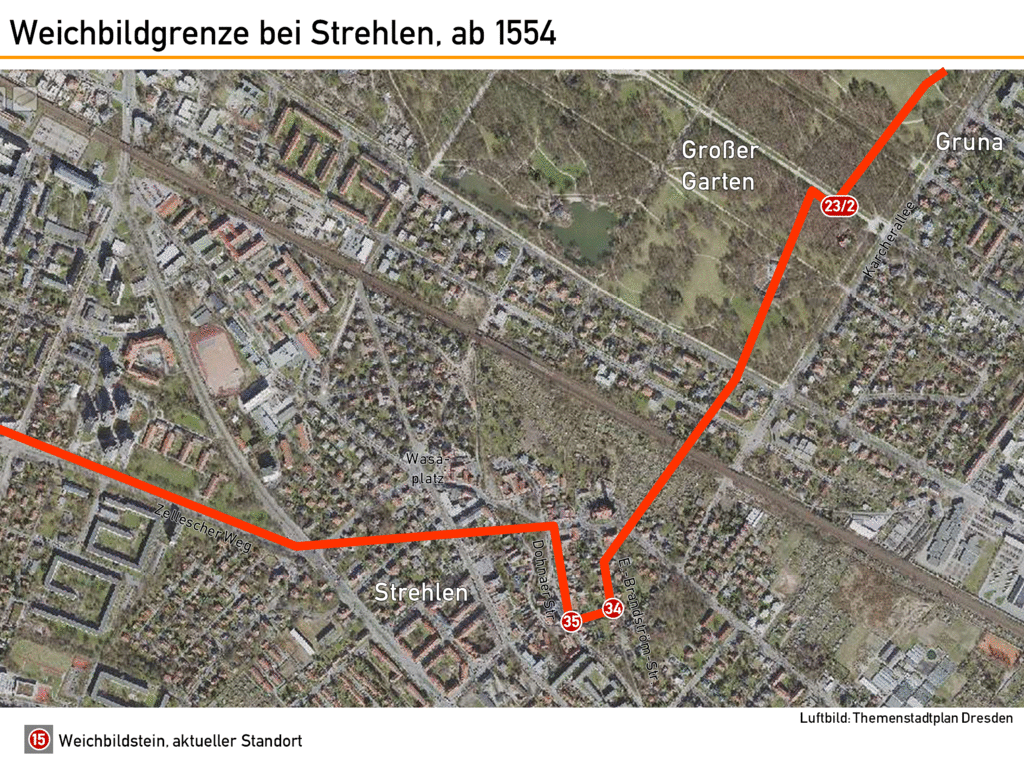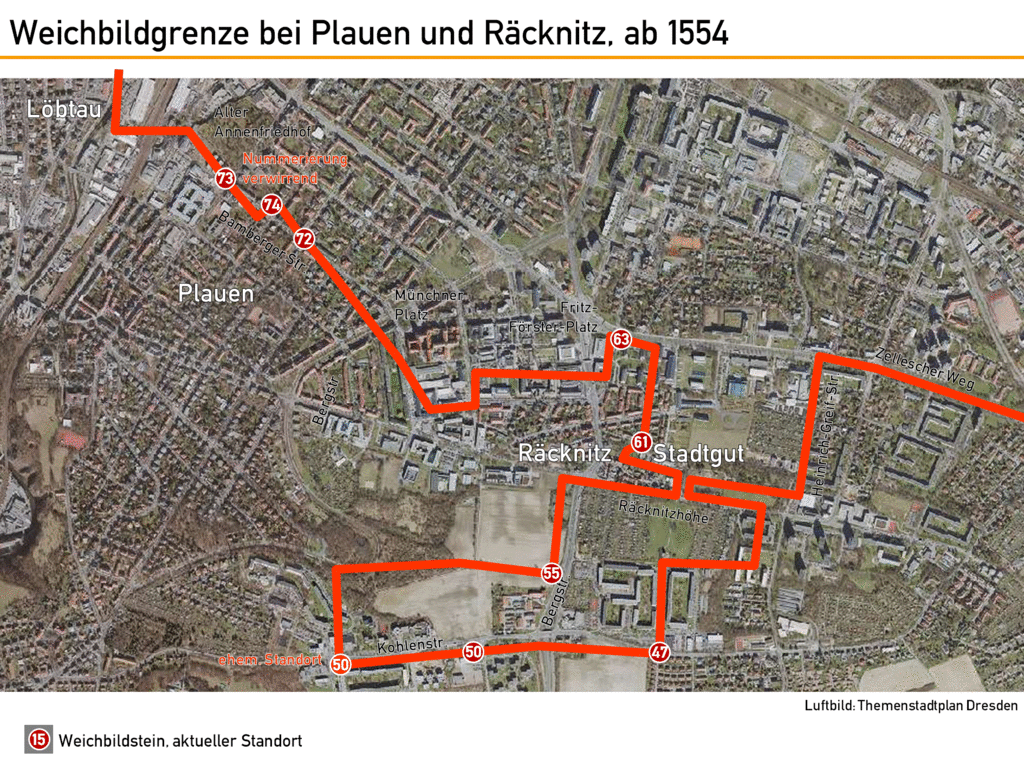Die Dresdner Weichbildgrenze
Jahrhundertelang lagen die Flurgrenzen der Stadt Dresden weit vor den eigentlichen Befestigungswerken. Die zwischen den Mauern der Stadt und der äußeren Grenze des sogenannten städtischen Weichbildes gelegenen Fluren unterstanden dabei der städtischen Gerichtsbarkeit, waren aber in der Regel unbebaut und wurden landwirtschaftlich genutzt.
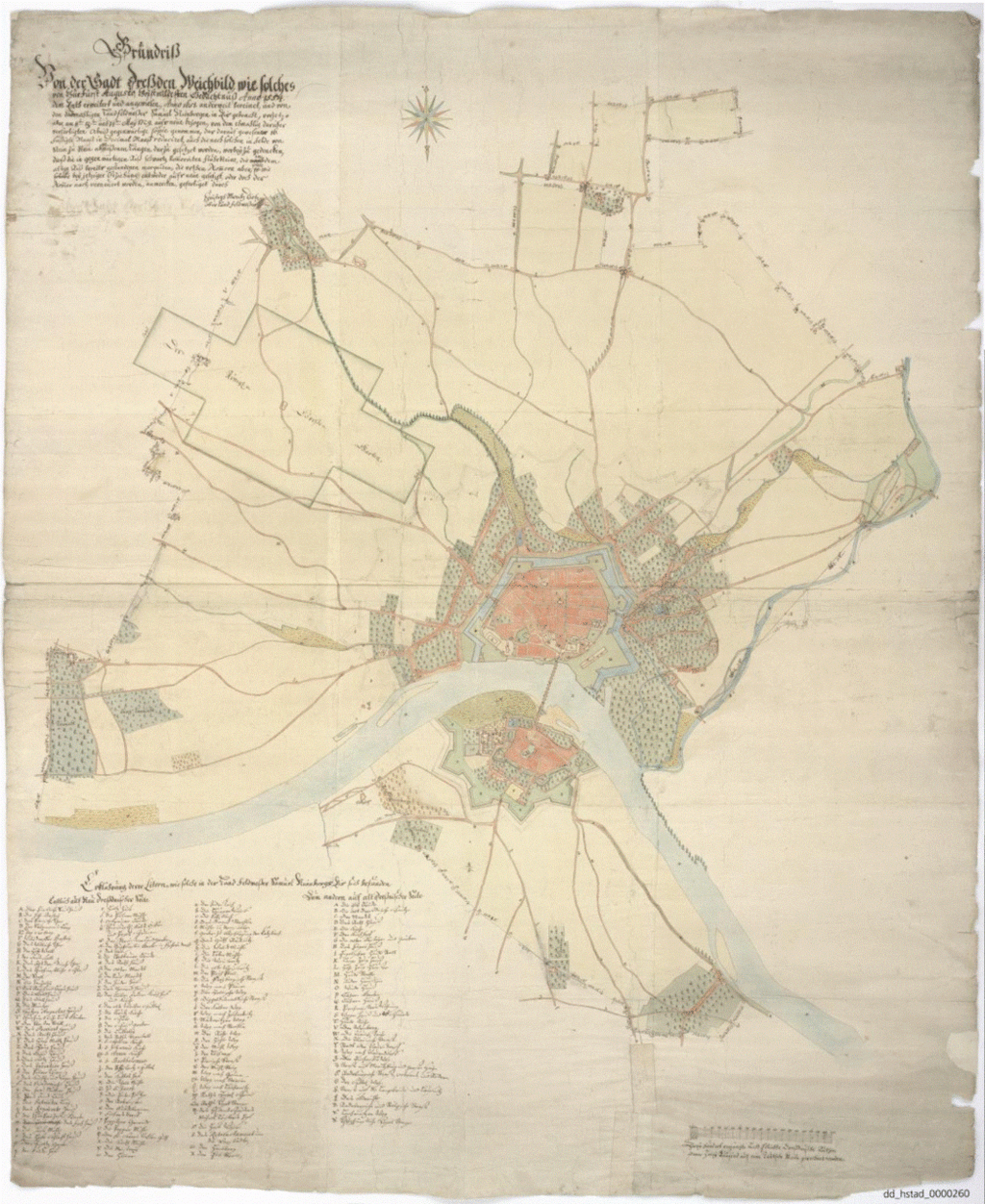
Gesüdeter Plan des Dresdner Weichbildes, Samuel Nienborg 1732, Deutsche Fotothek Dresden.
Im 16. Jahrhundert führten einschneidende Ereignisse dazu, dass jener Abgrenzung zwischen städtischem und landesherrlichem Territorium erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die Albertiner erhielten 1547 die sächsische Kurwürde, und Dresden stieg zur Hauptstadt des neugeordneten Kurfürstentums Sachsen auf. Der damit verbundene dramatische Bedeutungsgewinn wurde noch verstärkt durch die 1549 auf landesherrlichen Befehl vollzogene zwangsweise Vereinigung Altendresdens mit der linkselbischen Residenz. Der Kurfürst stattete diese mit neuen Privilegien und Territorien aus, was zu einer Neufestlegung der überkommenen mittelalterlichen Weichbildgrenzen führte. Die Stadt konnte es sich dabei leisten, an den die Grenze querenden Straßen und Wegen eine Vielzahl massiver und großer Markierungssteine aufzustellen, die dem Reisenden unmissverständlich anzeigten, dass er sich nun auf städtischem Gebiet und damit unter der Gerichtsbarkeit der Stadt Dresden befand.
Bis zu den großflächigen Eingemeindungen der Neuzeit blieb die nunmehr fixierte Stadtgrenze für Jahrhunderte unverändert, auch wenn sie zuletzt kaum noch eine praktische Rolle spielte. Mitunter folgen heute Straßenzüge der alten Weichbildlinie, manchmal entspricht diese der Grenze zwischen den Vorstädten namentlich der Altstadt und den anrainenden ehemals selbstständigen Gemeinden, oft aber verläuft sie quer durch die Grundstücke und ist in ihrem Verlauf kaum noch nachzuvollziehen.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Weichbildsteine fast noch durchgehend vorhanden, dann aber fielen die meisten der einsetzenden Bebauung zum Opfer. Einige Exemplare wurden 1911 dem Stadtmuseum übergeben, nur wenige überlebten bis heute an althergebrachter Stelle. Mittlerweile wurden allerdings die meisten noch vorhandenen Originale restauriert und an historischem Ort neu aufgestellt, dabei aus nachvollziehbaren Gründen manchmal auch leicht versetzt von ihren Originalstandorten. Grund genug, diesen unscheinbaren, aber immens bedeutenden historischen Zeitzeugen einen Besuch abzustatten und uns auf die Spuren der uralten Stadtgrenze zu begeben. Wir beginnen dabei auf Altendresdener, also Neustädter, Seite.