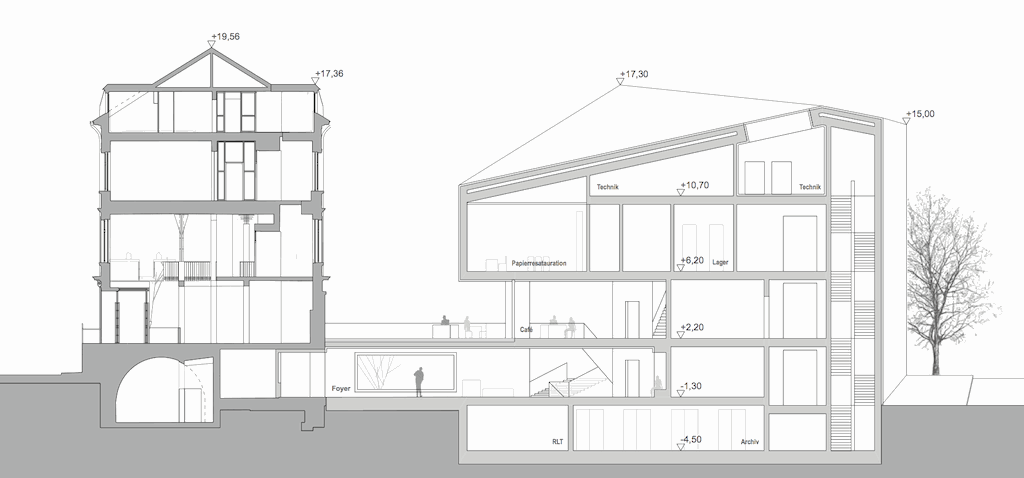Walter Gropius Fanclub duldet keine Widerrede
Wobei ich nicht einmal von kistenstapelnden Mainstream sprechen würde, sondern von abgeschiedenen Elfenbeinturm-Denken. Der BDA hat sich zu einem Bauhaus-Lobbyisten-Verein entwickelt. Das hat mit Avantgarde nichts mehr zu tun, sondern ist reine Vereinsmeierei in einem selbsternannten Walter-Gropius-Fanclub (den ich übrigens auch sehr schätze), der höchstens kleine Änderungen mit Fensterversatz und kubistische Anlehnungen als akzeptabel erachtet.
Ich habe nichts gegen eine intellektuelle Architektur-Vertretung, die sich mit der Moderne beschäftigt, aber wo sind die internen Grundsatzdebatten, die mal eine Weiterentwicklung ermöglichen würde? Der BDA greift nicht auf, er referenziert sich selber und beansprucht eine objektive Wahrnehmung ausschließlich für sich selbst. So entstehen Wettbewerbe, die keine sind, sondern implizite Absprachen, offensichtliche Mauscheleien und verzerrende Vetternwirtschaft. Das Zentrum der deutschen Architektur schlägt somit eindeutig in Berlin, bei der jede Widerrede zwecklos ist. Mit Demokratieverständnis, Pluralismus oder Individualismus hat das Ganze NICHTS mehr zu tun.